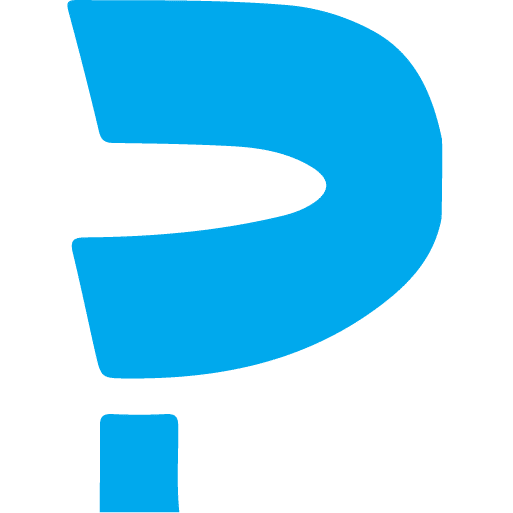Rund 80 Prozent aller Menschen wachsen laut dem Beitrag von Marisa Gierlinger vom ARD-alpha mit mindestens einem Geschwisterkind auf. Brüder und Schwestern begleiten uns oft ein Leben lang, vom Spielen im Kinderzimmer bis zu tiefen Gesprächen im Erwachsenenalter. Sie gelten für uns als eine Art Vorbild und stellen eine der wichtigsten und innigsten Beziehungen dar, die man im Leben haben kann. Hartmut Kasten, deutscher Entwicklungspsychologe, Frühpädagoge und Familienforscher erklärt, dass Geschwister in vielen Kulturen als emotionale Lebensanker, Rivalen und Vertraute zugleich gelten. Nahezu alle schriftlichen Überlieferungen der Menschheitsgeschichte erzählen dabei von Vertrauen und Nähe, aber auch von Konflikten, Feindschaft oder Entfremdung. (Kasten, 2020, S.11)
Trotz dieser Bedeutung hatte das Thema in der modernen Forschung lange Zeit ein Schattendasein. Erst in den 1920er-Jahren bekam das Thema durch die vom österreichischen Arzt und Psychotherapeuten Alfred Adler entwickelte Individualpsychologie seine verdiente Aufmerksamkeit. Erstmals wurde eine Verbindung zwischen dem Geburtsrang und den Eigenschaften der jeweiligen Geschwister festgestellt. Damals eine bahnbrechende Erkenntnis. (Kasten, 2020, S.13)
Heutzutage sind einige seiner Beobachtungen Allgemeinwissen. Erstgeborene gelten oft als verantwortungsbewusster und führungsorientierter. Letztgeborene sind dagegen kreativer und risikofreudiger. Mittelkinder sind tendenziell diplomatischer und kompromissbereit. Doch wie genau prägen Geschwister unsere persönliche Entwicklung auch jenseits bekannter Klischees?
Eng verbunden – Schwesterbeziehungen
Geschwisterbeziehungen prägen uns, aber nicht alle profitieren in gleicher Weise. So zeigen Studien, dass erstgeborene Schwestern häufig eine positive Beziehung zur Mutter durch die Geburt eines Geschwisterkindes entwickeln und dadurch einen höheren IQ-Wert erzielen als Einzelkinder. Eine enge Bindung zu seiner Schwester zu pflegen, kann in sehr schwierigen Lebensphasen wie etwa Krankheit, Trauer oder beruflichen Krisen ein wichtiger Ankerpunkt und Schutz sein. Zudem kann ein enger emotionaler Kontakt, wie es auch Inés Brock, deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Psychotherapeutin, (2020, S. 30) betont, Depressionssymptome verringern.
Laut Inés Brock (2020, S.52-53) zeigen Studien, dass gute und gepflegte Geschwisterbeziehungen sogar Konflikte zwischen Mutter und Kind abfedern können. Besonders häufig übernehmen ältere Schwestern eine soziale Führungsrolle. Sie hören zu, unterstützen emotional und übernehmen die Verantwortung für ihre jüngeren Geschwister. Mütter neigen zudem dazu, älteste Töchter als Vertraute einzubeziehen und ihnen Aufgaben anzuvertrauen, die sie aufwerten und stärken. Jüngere Schwestern profitieren dabei in ihrer sozialen und moralischen Entwicklung. In beiden Fällen sind Schwestern oft die stillen Stabilisatoren in der Familie. Weitere Studien zeigen zudem, dass ältere Schwestern in Konfliktsituationen, etwa bei Streit mit Gleichaltrigen, häufig als Vermittlerinnen auftreten. Diese Funktion kann jüngeren Geschwistern nicht nur emotionalen Rückhalt geben, sondern ihnen auch ein Modell für Konfliktlösungen liefern, das weit über die Kindheit hinauswirkt.
Gemeinsam stark – Brüderbeziehungen
Brüderbeziehungen sind oft von einer anderen Dynamik geprägt als Schwesterbeziehungen. Inés Brock fährt fort mit der Erklärung, dass während erstgeborene Schwestern oft vom Zuwachs eines Geschwisterkindes profitieren, erstgeborene Brüder laut Studien eher eine weniger positive Bindung zur Mutter entwickeln und im Schnitt schwächere kognitive Leistungen erzielen als Einzelkinder. Das Geschlecht des Erstgeborenen ist damit ein entscheidender Faktor für die Qualität der Geschwisterbeziehung. Mädchen gewinnen häufig soziale Kompetenzen, Jungen zeigen dagegen öfter emotionale Belastungen. (Brock, 2020, S.15)
Jungen bevorzugen gemeinsame Aktivitäten gegenüber langen Gesprächen. Bewegungsspiele, Wettkämpfe und sportliche Herausforderungen sind typische Formen, ihre Verbundenheit zu zeigen. Brüder agieren insgesamt aktiver und aggressiver, was in der Forschung als stärker konkurrenzgeleitet gilt. (Brock, 2020, S.56)
Trotz dieser Wettbewerbsorientierung gibt es eine tiefe Loyalität zueinander. Gemeinsame Interessen, geteilte Erlebnisse und sogar gemeinsam durchgestandene Schwierigkeiten schaffen oft eine brüderliche Verbundenheit, die lange anhält. Wer mit einem Bruder aufwächst, lernt früh, sich in einem oft direkten, raueren Austausch zu behaupten. Eine wichtige Erfahrung, die später in Teamsituationen oder Freundschaften von Vorteil sein kann.

Nähe ist der Schlüssel
Wie sehr uns Geschwister körperlich und psychisch beeinflussen, zeigt sich auch an einem unerwarteten Beispiel.
Eine Studie aus dem englischsprachigen Fachjournal „Pediatrics“ (Brock, 2020, S. 36) zeigt, dass Kinder mit jüngeren Geschwistern seltener von Adipositas betroffen sind. Das klingt auf den ersten Blick vermutlich ungewöhnlich, doch erklärt wird das durch veränderte Lebensstile. Durch jüngere Geschwister sind Kinder körperlich deutlich aktiver. Die Selbstregulation und Veränderung des Essverhaltens, sowie eine aktive Gestaltung der Freizeit werden als mögliche Ursache für diese Feststellung benannt. Brock (2020, S. 36-37) betont ebenfalls, dass auch das Immunsystem profitiert. Kinder mit Geschwistern kommen früh mit Keimen und Umweltreizen in Kontakt und sind deshalb besser gegen Allergien und Asthma gewappnet. Einzelkinder hingegen erleben diesen frühzeitigen „Trainingseffekt“ (Brock, 2020, S. 37) des Immunsystems oft nicht in gleichem Maße, was sich in einer höheren Anfälligkeit für bestimmte Allergien widerspiegeln kann.
Doch Nähe wirkt sich nicht nur auf die körperliche Gesundheit aus, sie ist auch ein emotionaler Schutzfaktor, wie auch Inés Brock (2020, S. 21) betont. Tatsächlich wurde herausgefunden, dass es für uns als soziales Wesen sehr wichtig ist, dass wir über längere Phasen nicht allein sein sollten. Körperliche Nähe ist ein wichtiger Aspekt für unser Wohlbefinden. Auch wenn es in Deutschland fast zur Normalität geworden ist, dass jedes Geschwisterkind ein eigenes Zimmer hat, ist es für die emotionale Stabilität wichtig, dass Geschwister miteinander Geheimnisse teilen und unbeobachtete Nähe haben können.

Psychisches Immunsystem
Anhand einer Studie von Susanne Seyda, Diplom-Volkswirtin und Thomas Lampert, Gesundheitsforscher, zeigt Inés Brock (2020, S. 39), dass das Risiko von psychischen Krankheiten durch eine höhere Geschwisteranzahl sinkt. Der Umgang mit Krisen beginnt mit Geschwistern früh. Beispielsweise gelingt die Eingewöhnung in Kitas oft leichter, da Geschwister bereits gelernt haben, Konflikte auszuhalten, Bedürfnisse zurückzustellen und soziale Regeln zu verinnerlichen. Fehlen solche frühen sozialen Trainingsfelder, müssen Fähigkeiten wie Frustrationstoleranz oder das Verhandeln von Regeln später in anderen sozialen Kontexten erlernt werden, was laut Studie mitunter mit mehr Stress verbunden ist (Brock, 2020, S. 39).
Was banal klingt, hat tiefgreifende Effekte. Das frühe Spielen mit Geschwistern fördert laut Brock (2020, S. 39-40) die Entwicklung eines empathischen Gehirns. Unbeaufsichtigtes Spielen mit anderen Kindern stärkt die Selbstregulation und bietet einen wichtigen Schlüsselfaktor für psychische und körperliche Gesundheit im Erwachsenenalter. Willenskraft und Selbstkontrolle gelten in der Hirnforschung als bedeutende Gesundheitsfaktoren und beides wird im intensiven Miteinander mit Geschwistern besonders trainiert.
Unbemerkt geprägt
Wie Inés Brock feststellt, besteht rund ein Drittel der frühen Interaktion zwischen jüngeren Geschwistern aus Imitation. (2020, S.19) Dieses unbewusste Lernen, etwa beim Sprachgebrauch, bei sozialen Regeln oder im Umgang mit Emotionen, schafft ein Fundament, auf dem spätere Fähigkeiten aufbauen. Ältere Geschwister übernehmen dabei oft die Rolle von Lehrenden, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Regeln und Rollen vorleben. Das gilt sowohl für praktische Fähigkeiten wie Fahrradfahren oder Lesen, als auch für die ungeschriebenen sozialen Gesetze innerhalb der Familie. (2020, S.33)

Wie Geschwister uns im Erwachsenenalter beeinflussen
Was wir von unseren Geschwistern lernen, hört nicht im Erwachsenenalter auf. Viele dieser Prägungen begleiten uns ein Leben lang, selbst in Lebensbereichen, in denen wir es vielleicht gar nicht erwarten würden. Auch bei der Wahl unserer Partner:innen mischen laut Inés Brock (2020, S. 28) Geschwistererfahrungen mit.
Studien zeigen, dass Geschwisterbeziehungen auch auf die spätere Partnerauswahl und Beziehungsdynamik einen Einfluss haben. Die Geburtenreihenfolge kann beeinflussen, welchen Persönlichkeitstypen wir anziehend finden und wie wir Konflikte in der Partnerschaft austragen. Wer mit einem Geschwisterkind des anderen Geschlechts aufgewachsen ist, bringt oft ein stärkeres Verständnis für die Denk- und Verhaltensweisen des anderen Geschlechts mit. Das liegt daran, dass sie über Jahre hinweg zusammengelebt und dadurch gemeinsame Alltagserfahrungen gesammelt haben, die sich auf den Partner oder die Partnerin dann übertragen lassen.
Auffällig ist auch, dass viele Menschen Partner:innen wählen, die Gemeinsamkeiten mit einem Familienmitglied haben, oft sogar dem Geschwisterkind ähneln. So betont Brock (2020, S. 28) weiter, dass in vielen Fällen Geschwister die Partnerschaft durch frühere Konflikte, Muster, Rollenverteilungen oder auch Verhaltensweisen aus der Kindheit prägen, oft deutlich stärker als die eigenen Eltern. Wer als Kind gelernt hat, dass Stress schnell eskaliert, wird diese Dynamik oft auch in der Partnerschaft unbewusst reproduzieren. Umgekehrt kann eine konstruktive Streitkultur unter Geschwistern dazu führen, dass spätere Beziehungen harmonischer verlaufen. Liegt die Liebe am Ende also in den Genen oder doch in der Prägung aus dem Kinderzimmer?
Wie Geschwister uns in der Jugend beeinflussen
In der Pubertät wollen Jugendliche meist nicht weniger als ihren Eltern zu ähneln. Doch das bedeutet nicht, dass sie keine Vorbilder haben. Oft rücken in dieser Phase die Geschwister in den Mittelpunkt der Orientierung. Ältere Brüder oder Schwestern können in dieser Lebensphase eine wichtige Leitfigur werden, die man entweder anhimmelt oder insgeheim ihre Eigenschaften übernehmen möchte. Psychologische Fachkräfte sprechen hier von „Verschmelzungswünschen“ (Brock, 2020, S. 25), dem inneren Drang, so zu sein wie ältere Geschwister.
Ein Beispiel: Der 14-jährige Lukas hört plötzlich dieselbe Musik wie seine 18-jährige Schwester, zieht ähnliche Kleidung an und imitiert sogar ihre Art zu sprechen. Was nach Nachahmung aussieht, ist in Wirklichkeit ein wichtiger Schritt der Identitätsfindung.
Gleichzeitig verdeutlicht Brock, dass dazu auch die bewusste Abgrenzung gehört, irgendwann seine eigene Rolle zu finden und sich somit von seinen Geschwistern zu unterscheiden. (2020, S. 25) Irgendwann wird Lukas bewusst, dass er eigene Vorlieben entwickeln möchte und löst sich Stück für Stück von seinem Vorbild. Diese Wechselwirkung aus Nähe und Abgrenzung ist ein zentraler Bestandteil der Identitätsentwicklung und prägt die spätere Selbstwahrnehmung oft stärker als der Einfluss der Eltern.

Wenn Rollen neu verteilt werden
Stiefgeschwister sind leiblich nicht verwandt, wachsen aber durch die Partnerschaft ihrer Eltern meist unter einem Dach auf. Dabei prallen laut Brock (2020, S. 81-82) oft zwei Familiensysteme mit eigenen Regeln, Werten und Alltagsroutinen aufeinander. Die Geschwisterreihenfolge kann sich komplett verschieben. Einzelkinder werden plötzlich zu jüngeren oder älteren Geschwistern, Erstgeborene verlieren ihren Platz an jemand Neues.
„Was alle Kinder verbindet, ist die gemeinsame Erfahrung, dass für keinen mehr eine vertraute Gegebenheit da ist“, fährt Inés Brock fort und zitiert dabei Bethke-Brenken und Brenken aus ihrem Werk „Mut zur Patchwork-Familie. So gelingt das neue Miteinander“. (2011, S. 135). Konkurrenzverhalten in Patchworkfamilien ist deshalb oft weniger Ausdruck von Rivalität als vielmehr ein Signal von Verunsicherung und dem Gefühl, den eigenen Platz neu finden zu müssen. Besonders wichtig ist laut Brock, dass in einer solchen Konstellation, Geschwister, wenn möglich, nicht voneinander getrennt werden. Sie können in Umbruchzeiten eine wertvolle Beziehungskontinuität sichern und emotional eine Sicherheit geben. Stiefgeschwister bringen eine zusätzliche Herausforderung mit. Im Unterschied zu Freundschaften oder auch Schulkontakten lassen sich diese Begegnungen nicht einfach vermeiden, sondern sie dringen in die Privatsphäre ein und schaffen Nähe, ob gewollt oder nicht.
Auch ohne Kontakt unzertrennbar
Geschwisterbeziehungen sind oft über Jahrzehnte hinweg mal enger, mal lockerer und manchmal brechen sie auch ganz ab. Doch erstaunlicherweise bleiben sie laut Inés Brock selbst dann ein sehr wichtiger Teil des eigenen Lebens. Psychologische Fachkräfte sprechen dabei von einer „inneren Repräsentanz“. Geschwister sind in unserem Selbstbild und in unserer Biografie stark verankert, unabhängig davon, ob wir Kontakt haben oder nicht. Sie haben im Normalfall unsere Kindheit geprägt, unsere Werte und oft auch unsere Entscheidungen beeinflusst. Diese unsichtbare Verbindung bleibt für immer bestehen. (2020, S. 27)

Ein Leben lang
Einzelkinder fehlen diese intensiven Alltagsbeziehungen, sowohl die Reibungen als auch der Rückhalt. Viele Einzelkinder suchen sich daher Ersatzstrukturen. Enge Freundschaften, Vereinsleben oder Mentorenfiguren helfen ihnen dabei, diese wichtigen Beziehungen zu ersetzen. Diese können ähnliche Funktionen übernehmen, doch die tägliche, unausweichliche Auseinandersetzung, wie sie Geschwister bieten, lässt sich nur schwer imitieren.
Geschwister sind somit mehr als nur Spielfreunde oder Rival:innen. Sie prägen unseren Körper und Geist, formen unser soziales Verhalten, stärken unsere Widerstandskraft und beeinflussen sogar unsere Partnerwahl. Ihre Wirkung entfaltet sich oft leise und unbemerkt, doch gerade diese Einflüsse wirken ein Leben lang nach. Wer mit Geschwistern aufwächst, trägt ein Beziehungsnetz in sich, das ein Leben lang nachwirkt, sichtbar oder auch unsichtbar.
Literaturverzeichnis
Buchquellen:
Kasten, H. (2020). Geschwister: Vorbilder, Rivalen Vertraute (7. Aufl.). Ernst Reinhardt Verlag.
Brock, I. (2020). Geschwister verstehen: Professionelle Begleitung von Kindern und Erwachsenen. Ernst Reinhardt Verlag.
Internetquelle:
Gierlinger, M. (2024,19. November). Wie wichtig sind Geschwister? ARD alpha.
| Hartmut Kasten Dr. Hartmut Kasten ist Entwicklungspsychologe und war lange Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Staatsinstitut für Frühpädagogik in München. Er hat zahlreiche Fachbücher über Geschwisterbeziehungen, Bildung und kindliche Entwicklung veröffentlicht. |
| Inés Brock Dr. Inés Brock ist Erziehungswissenschaftlerin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Sie arbeitete in der Beratung von Familien und ist spezialisiert auf die Begleitung von Kindern und Erwachsenen in besonderen Lebenssituationen. Ihr Schwerpunkt liegt auf Geschwisterdynamiken und deren Bedeutung für die Entwicklung. Freiberuflich arbeitet sie ebenfalls als Dozentin und Supervisorin. |